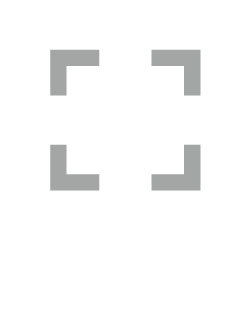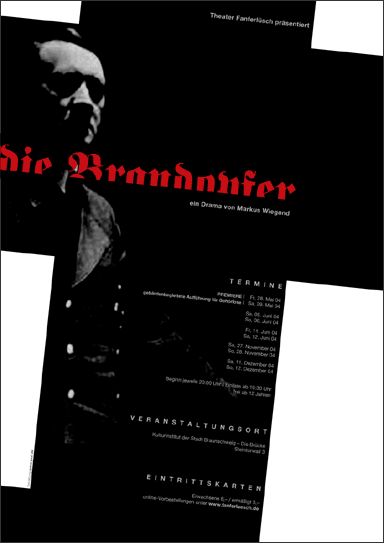
Plakat: Carsten Schrödter
Es ist der 18. Juli 1944 in Berlin, und in der Spree wird die Leiche eines Mannes gefunden, der, wie es sich sehr bald herausstellt, ein Spitzel der SS bei der Familie des Generaldirektors Meinhardt war.
Der Chef der Berliner Mordkommission, Karl von Amwege, will in diesem Fall wohlweißlich nicht weiter ermitteln – jedoch laufen die Dinge eben manchmal anders, als einem lieb ist. Schon bald finden er und seine Kollegen Erika Kessler und Rolf Beilke sich inmitten einer Intrige wieder, als die Parteiführung sich für den Fall zu interessieren beginnt.
Zum Stück
Das Drama vertsteht sich als Beitrag zur Aufarbeitung des dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte – ohne den moralischen Zeigefinger erheben zu wollen – geschrieben, inszeniert und aufgeführt von der Generation, deren Eltern Kleinkinder waren, als der Krieg zu Ende ging.
„Viele Bürger der Bundesrepublik Deutschland glauben ernsthaft, dass sie im Dritten Reich im Widerstand gewesen wären. Optimisten würden wahrscheinlich die Theorie aufstellen, dass diese Überzeugung Ausdruck eines in über fünfzig Jahren gewachsenen Demokratiebewußtsein sei. Politische Optimisten sind aber, wie politische Pessimisten, nichts anderes als Extremisten – und deshalb für die Demokratie schädlich. Wer illusionsfrei ist, erkennt, dass es gesellschaftliche Automatismen gibt, die immer wieder greifen. Die Bundesbürger sind keine besseren Menschen als die Reichsangehörigen, und es ist deshalb also mehr als wahrscheinlich, dass auch die meisten von uns (wenn es die Umstände erfordern würden) in Reih und Glied zur Militärmusik marschierten, auch, wenn uns dann, wie Albert Einstein es so pointiert formulierte, statt eines Gehirns ein zentraler Nervenknoten reichen würde… Auch wir würden durch den Teil unserer Seele verführt und verraten werden, der noch immer in einer Höhle im Neanderthal haust. Und deshalb schreibe ich gegen meine Angst an, was ich von 1933 bis 1945 gemacht hätte.“
Karl von Amwege: Ick bin nur Komparse in dieser Tragikkomödie. Wie Sie, Beilke. Wir möjen beede dit Rampenlicht, aber wir haben keenen Einfluss uff den Spielplan.
Rolf Beilke: Aber wir hätten ja nich so jut spielen brauchen…
Szenenfotos
No Supported Files in Gallery
| Regie | Markus Wiegand |
| Karl von Amwege | Carsten Schrödter |
| Rolf Beilke | Nikolai Radke |
| Erika Kessler | Daniela Willke |
| Hilde Meinhardt | Bettine Schulz |
| Willhelm Meinhardt | Wolfram Lührig |
| Lena Meinhardt | Jana-Aletta Thiele |
| Frank Wieben | Christian Löchte |
| Heinrich Himmler | Stefan Damm |
| Audioeffekte & Musik | Malte Krug |
| Licht- und Tontechnik | Christoph Schnerch |
| Charlotte Mikolajek | |
| Saskia Polze |
Pressestimmen
Ein Drama, das nachdenklich macht
Kritik der Braunschweiger Zeitung vom 01.06.2004 von Karsten Mentasti zum Stück „Die Brandopfer„: Theatergruppe Fanferlüsch wagte sich in der Brücke mit „Die Brandopfer“ an schwieriges Thema heran Ein schwieriger Stoff, dem sich die freie Theatergruppe Fanferlüsch und ihr Regisseur und Autor Markus Wiegand gestellt haben. „Die Brandopfer„, zweite abendfüllende Eigenproduktion von Fanferlüsch in der Theatersaison 2003/2004, spielt im Juli 1944, im Dirtten Reich. Der missglückte Attentatsversuch von Widerstandskämpfern auf Adolf Hitler bildet in dem fünfaktigen Drama von Wiegand den geschichtlichen Hintergrund.